„Friedensstatue“ nicht immer erwünscht“.
Schätzungsweise 200.000 Mädchen und Frauen – meist minderjährig – wurden im Zweiten Weltkrieg (1937-1945) durch das japanische Militär systematisch in Militärbordelle, in sexuelle Sklaverei entführt. Betroffen waren Frauen aus dem asiatisch-pazifischen Raum, aus 13 verschiedenen Ländern: Burma, China, Ost-Timor, Indonesien, Japan Malaysia, Niederlande, Nordkorea, Papua-Neuguinea, Philippinen, Südkorea, Taiwan und Thailand.
Erst 50 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs haben überlebende Frauen ihr Schweigen durchbrochen. Am 14. August 1991 fasste Kim Hak-Soon den Mut und trat öffentlich im Fernsehen auf, um zu sagen: „Ich war eine ‚Trostfrau‘ für das japanische Militär.“ 238 Frauen aus Südkorea schlossen sich dieser Aussage an und sagten gegen die japanische Regierung aus. Seit 1992 demonstrieren Überlebende und Unterstützer:innen jeden Mittwoch vor der japanischen Botschaft in der koreanischen Hauptstadt Seoul und fordern Entschuldigung und Entschädigung für die Kriegsverbrechen an den Frauen.
Hwang Kum-Ju, eine von ihnen, erzählte im Alter von 83 Jahren:
„Mit 12 Jahren kam ich aus der Provinz in die Stadt Hamhung. Mit 19 meldete ich mich auf einen japanischen Aufruf, sie suchten Mädchen und junge Frauen als Fabrikarbeiterinnen. Mein Arbeitsplatz sollte in der Mandschurei sein. Nach zwei Jahren – so versprachen die Japaner – könnte ich wieder in meine Heimat zurückkehren. Tatsächlich haben sie mich sechs Jahre dort festgehalten und Jahrzehnte lang habe ich mit niemandem darüber reden können, was ich damals erleiden musste. Ich habe meine Vergangenheit aus Scham nach dem Krieg verheimlicht … Erst in den 90iger Jahren – als Kim Hak-Su im Fernsehen dazu aufrief, das Schweigen zu brechen, ging auch ich an die Öffentlichkeit.
Mir geht es nicht ums Geld. Meine verlorene Jugend lässt sich nicht wieder gut machen, aber so lange ich lebe warte ich auf ein Schuldeingeständnis aus Tokio.“
Am 14.12.2011 fand in Seoul die 1000. Mittwochsdemonstration statt. Aus diesem Anlass wurde die FRIEDENSSTATUE aufgestellt – gestaltet vom koreanischen Künstlerehepaar Kim Seo-Kyung und Kim Eun-Sung.
Kopien davon stehen seitdem in Australien, Kanada, Europa und den USA und seit 8. März 2025 nunmehr auch in Köln, wenn auch nur für drei Monate während der Ausstellung „Die Dritte Welt im Zweiten Weltkrieg“. Die Enthüllung der Statue in Köln war allerdings erst nach massivem öffentlichem Protest möglich. *)

Die STATUE – Details mit Bedeutung (von Nataly Jung-Hwa Han)
Jedes Detail der FRIEDENSSTATUE erzählt eine Geschichte:
Die Abgebildete trägt eine koreanische Tracht (Hanbok), wie sie Mädchen damals oft trugen, als sie zu Opfern des japanischen Militärs wurden.
Das Mädchen ist minderjährig, höchstens 13 bis 15 Jahre alt, so wie viele, die während des Kriegs in die Frontbordelle verschleppt wurden.
Der leere Stuhl steht für Verlassenheit. Denn viele der Opfer starben, ohne je Entschuldigungen oder Entschädigungen für die an ihnen verübten Verbrechen erlebt zu haben.
Die Haare des Mädchens sind zerzaust. Dabei pflegten koreanische Mädchen ihre Haare stets sehr sorgfältig. Die grob geschnittenen Haare erinnern daran, dass die Betroffenen aus ihrem Leben gerissen und per Gewalt aus ihren Heimatorten und ihren Familien entführt wurden.
Der Vogel symbolisiert die Sehnsucht nach Freiheit. Vögel fliegen hoch im Himmel, aber kehren zur Erde zurück.
Die geballten Fäuste des Mädchens symbolisieren ihren festen Entschluss, von nun an nicht mehr über die Kriegsverbrechen des japanischen Militärs zu schweigen, sondern die Wahrheit zu erzählen.
Die schwarzen Steine stehen für die Leiden der Frauen. Der Schatten gehört zu einer der Frauen und verweist auf die Zeit, die seit den Verbrechen im Zweiten Weltkrieg vergangen ist.
Der weiße Schmetterling ist in ganz Asien das Symbol für die Wiedergeburt, die Verbindung von Diesseits und Jenseits und die Hoffnung, dass die verstorbenen Frauen als Schmetterlinge auf die Erde zurückkehren, um die Entschuldigungen zu erhalten, die ihnen zu Lebzeiten verwehrt wurden.
Das Mädchen ist barfuß, und ihre Fersen stehen nicht fest auf der Erde. Sie hängen in der Luft wie viele der Betroffenen, die nach dem Krieg aus Scham nicht nach Hause zurückgekehrt sind.
Die Inschrift auf dem Boden neben der Statue verweist darauf, dass sexualisierte Gewalt bis heute in allen Kriegen weiterhin verübt wird.
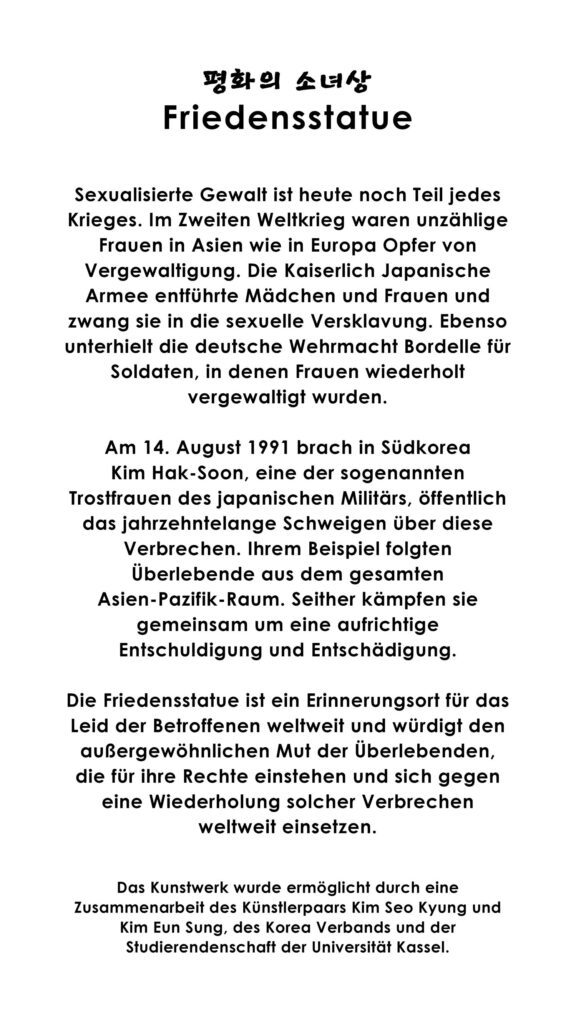
*) Hintergrund zum Verbot: Japanische Behörden protestieren seit jeher, wo immer eine Friedensstatue aufgestellt werden soll. So machten sie auch Druck auf Kölner Lokalpolitiker:innen. Ein Mitglied der Bezirksvertretung Innenstadt, das anonym bleiben möchte, erhielt ein dreiseitiges Schreiben von einem japanischen Abgeordneten. Es lag – drei Tage vor der Enthüllung der Statue vor dem NS-DOK – im Postfach des Bezirksrathauses, der Absender: Japanisches Generalkonsulat Düsseldorf.
Ein Grund für die Stadt Köln, sich japanischen Stellen gegenüber gefällig zu erweisen, ist sicherlich die Städtepartnerschaft zwischen Köln und Kyoto.
Die Verwaltung der Stadt Köln wollte die Statue im „nicht öffentlichen Raum“ ausstellen und schlug den Innenhof der Kirche St. Maria in der Kupfergasse vor. Recherchen ergaben, dass diese Kirche ein Zentrum des Opus Dei ist – laut Kölner Stadt-Anzeiger „eine fromme Vereinigung, die für die Anliegen der Frauen schon aus Tradition nicht viel übrighat“.
(Opus Dei ist in Spanien gegründet worden und hat den Diktator Franco unterstützt).
Viele Bürgerinnen und Bürger, Institutionen und Einzelpersonen aus Köln und anderen Städten und Ländern haben den von recherche international e.V., Asien- und Frauengruppen entworfenen Offenen Brief an die Oberbürgermeisterin unterzeichnet und damit erreicht, dass auch die Bezirksvertretung Innenstadt diesen Protest mitgetragen und einstimmig für die Aufstellung der „Friedensstatue“ vor dem NS-DOK votiert hat.
Weitere Informationen: www.3www2.de
Christa Aretz
